
von Alexander Lost | 4. Jan. 2018 | Allgemein, Aus der Kanzlei
Das Jahr fängt ja gut an!
Zunächst aber möchte ich allen Mandantinnen und Mandanten und auch allen sonstigen Leserinnen und Lesern ein schönes und glückliches Jahr 2018 wünschen.
Auf in die Zukunft!
Am 01.01.2018 sollte in Deutschland eigentlich der elektronische Rechtsverkehr so richtig durchstarten. Den gibt es z.B. in Österreich schon seit Ewigkeiten, und dort werden über 90 % der Klagen elektronisch bei Gericht eingereicht, was vielen deutschen Anwälten wie eine wahnsinnige Science-Fiction-Dystopie vorkommen mag. Aber jetzt sollte es auch hier ernsthaft losgehen.
Dafür hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ein ganz eigenes System entwickeln lassen. Dieses trägt den Namen „besonderes elektronisches Anwaltspostfach“ (beA). Über dieses beA können, Moment: konnten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte rechtswirksam mit bestimmten Gerichten, sonstigen Justizbehörden und untereinander kommunizieren. Klingt erstmal praktischer als die Post.
Dreh- und Angelpunkt bei der Entwicklung des beA war natürlich die Sicherheit des Postfachs und die Vertraulichkeit der Daten, die darüber übermittelt werden sollen. Um die Entwicklungskosten aufzubringen, wurden die deutschen Rechtsanwältinnen und -anwälte herangezogen. Insgesamt kamen dadurch bisher so ca. EUR 38.000.000,- zusammen, das ist eine ganz schöne Menge Geld. Stellen Sie sich einfach vor, wie lange Ihre Oma dafür stricken müsste!
Der 01.01.2018 ist ein wichtiges Datum, da seit diesem Tage eine sogenannte passive Nutzungspflicht dieses Anwaltspostfaches besteht. Das heißt, jeder Anwalt und jede Anwältin ist nach dem Gesetz verpflichtet, die technischen Voraussetzungen empfangsbereit vorzuhalten, um Mitteilungen über das beA zur Kenntnis nehmen zu können. Natürlich habe ich als gesetzestreuer Anwalt alle Vorkehrungen getroffen und nutze das Postfach bereits seit fast einem Jahr. Viele Kollegen und Kolleginnen schimpfen darüber, aber trotz schwerfälliger und umständlicher Bedienung hat sich das eigentlich als sehr praktisch und jedenfalls nach meiner Erfahrung auch zuverlässig erwiesen.
Stop! Kommando zurück!
Leider wurde das beA kurz vor dem Jahreswechsel vom Netz genommen, und keiner weiß, wann und in welcher Form es wieder zur Verfügung stehen wird. Man kann nichts mehr senden oder empfangen.
Mir fehlt das IT-Verständnis, um korrekt wiedergeben zu können, was da passiert ist. Es ist bei golem.de unter dem beunruhigenden Titel „Bundesrechtsanwaltskammer verteilt HTTPS-Hintertüre“ verhältnismäßig anschaulich dargestellt.
Wenn Sie den Artikel lesen, werden Sie vielleicht fragen: „Was? Die BRAK hat den Anwälten zum Fixen des Problems ein Zertifikat zum Download zur Verfügung gestellt, das völlig neue Sicherheitslücken reißt und nunmehr dringendst deinstalliert werden sollte?“ Die Antwort hierauf lautet: Jawohl, das kann man so sagen.
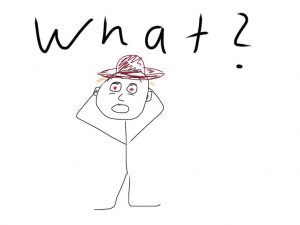
Den aktuellen Stand kann man auf derselben Seite nachlesen, nunmehr betitelt „Noch mehr Sicherheitslücken im Anwaltspostfach“. Diese Überschrift ist selbst für technische Laien gut verständlich.
Die BRAK hat immerhin angegeben, dass die Vertraulichkeit der über das beA übersandten Dokumente stets gewährleistet gewesen sei. Ebenso sei kein Angriff auf ein Anwalts-Postfach unter Ausnutzung der Sicherheitslücken erfolgt. Zumindest die erste Aussage wird in IT-Kreisen allerdings stark angezweifelt.
Als wäre das nicht genug, hat die BRAK anfangs auch noch überaus ungeschickt kommuniziert. So konnte kurzzeitig der Eindruck entstehen, dass Markus Drenger vom Chaos Computer Club Darmstadt das Problem verursacht habe – tatsächlich hat Herr Drenger die BRAK darauf hingewiesen, dass u.a. diese enorme Sicherheitslücke existiert! Natürlich hat sich die Formulierung der BRAK als Missverständnis herausgestellt. Kurz darauf beauftragte die BRAK eine Kommunikationsagentur. Mittlerweile liegt auch eine Stellungnahme des Präsidenten der BRAK vor, aus der man erkennen kann, dass hier wirklich ein Problem besteht.
Aktuell ist nicht absehbar, wann das beA wieder online geht und ob es überhaupt in der bisher geplanten Form Bestand haben kann. Der passiven Nutzungspflicht kann die Anwaltschaft derzeit jedenfalls nicht wie vorgesehen nachkommen. Derzeit kann allerdings auch nichts über das beA gesendet und somit auch nichts empfangen werden.
Zurück in die Vergangenheit!
Und nun?
Tja, nun habe ich mal das gute alte Faxgerät entstaubt, die Brieftaube wieder eingestellt und über den Jahreswechsel Holz gesammelt, um per Rauchzeichen mit den Gerichten kommunizieren zu können. Das beA lässt wohl noch etwas auf sich warten. Schauen wir mal, wann die Zukunft endlich beginnt.


von Alexander Lost | 21. Dez. 2017 | Besinnlichkeit, Weihnachten
Schneeweiß die Straßen
Und still die Stadt
Verdächtig!
Ob wer was verbrochen hat?
Es knirscht der Neuschnee
Unter den Füßen
Wird der Chef dieses Jahr
Mit nem Bonus versüßen?
Das Licht in den Fenstern
Funkelt weihnachtlich warm
Verlier‘ ich den Prozess
Himmel! Dann bin ich arm.
Es brutzelt die Ente
Im summenden Herd
Ihr ist es egal:
Was ist meine Anlage wert?
Die Frau macht ein Foto
Mit den Kindern, den beiden
Ich lache verlogen
Wir lassen uns scheiden.
Am Baum – echte Kerzen
Ein Flammenmeer
Der Versicherungsmensch:
„Da können wir leider nichts machen, bitte lesen Sie das Kleingedruckte, mein Herr.“
Es weihnachtet wieder
Draußen ist‘s kalt
Von Herzen grüßt Sie
Ihr Rechtsanwalt


von Alexander Lost | 15. Dez. 2017 | Recht der Handelsvertreter, Stornoprovision, Stornoreserve, Vertriebsrecht
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in einer vertriebsrechtlichen Entscheidung vom 13.09.2017 entschieden, dass die DVAG keine Stornoprovisionen von meiner Mandantin verlangen kann. Stattdessen musste DVAG die fällige Stornoreserve vollständig an meine Mandantin auszahlen. Die Entscheidung ist veröffentlicht in der Zeitschrift für Vertriebsrecht, Jahrgang 2017, Heft 6, Seite 377 (mit Anmerkung RA Lost). Der Verlag hat mir freundlicherweise den Abdruck gestattet.
Einleitung
Das Urteil ist der Schlusspunkt mehrerer Verfahren seit dem Jahr 2013, die vom Amtsgericht Adelsheim über das Landgericht Mosbach bis schließlich nach Karlsruhe zum OLG führten. Die Kosten sämtlicher Verfahren musste DVAG tragen.
Ausgangspunkt für die Verfahren waren die Abrechnungen der DVAG gegenüber der Vermittlerin. Diese Abrechnungen wiesen einen Saldo zu Lasten der Vermittlerin (sog. Sollsaldo) auf. Den Sollsaldo hat DVAG im Wege der Klage geltend gemacht.
Eine Stornoreserve zugunsten der Vermittlerin war zwar in den älteren Abrechnungen ausgewiesen gewesen. Diese Stornoreserve wurde jedoch von DVAG vollständig mit Stornierungen verrechnet, so dass laut Abrechnung nichts davon übrigblieb. Ich habe im Prozess bestritten, dass die Verrechnungen der DVAG berechtigt seien und Widerklage auf Auszahlung der Stornoreserve erhoben.
Die Gerichte hatten nunmehr also zwei Fragen zu beantworten:
- Steht der DVAG der Anspruch aus ihrer Abrechnung ganz oder teilweise zu?
- Steht der Vermittlerin ein Anspruch auf Auszahlung ihrer Stornoreserve ganz oder teilweise zu?
Wie sich zeigen wird, hängen diese beiden Fragen eng miteinander zusammen.
Kein Anspruch der DVAG auf Stornoprovision
Die Abrechnung im Handelsvertreterverhältnis muss von Gesetzes wegen durch den Unternehmer/Vertrieb (also hier die DVAG) erfolgen. Ob diese Abrechnung wirklich korrekt ist, zeigt sich häufig erst in einem Gerichtsverfahren nach Beendigung des Vermittlervertrages.
Legt der Vertrieb also seine Abrechnung bei Gericht vor, so kann es für den Vermittler ausreichend sein, schlicht zu bestreiten, dass die Abrechnung richtig sei. Denn es ist der Unternehmer, der die Abrechnungshoheit hat und für die Richtigkeit seiner Buchungen verantwortlich ist.
Ausnahme: Saldenanerkenntnis
Hat die Vermittlerin oder der Vermittler im Laufe des Vertragsverhältnisses ein Saldenanerkenntnis abgegeben, so kann er oder sie jedenfalls bis zu dem anerkannten Saldo
nicht einfach die Richtigkeit der Abrechnung bestreiten. Denn mit dem Saldenanerkenntnis erklärt die Vermittlerin oder der Vermittler ja gerade, dass die Abrechnung korrekt sei.
In diesem Fall müsste die Vermittlerin bzw. der Vermittler also schon im Einzelnen darlegen, welche Positionen trotz des Anerkenntnisses falsch oder zu Unrecht abgerechnet wurden.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Anerkenntnis wirksam abgegeben wird. Hieran sind recht strenge Anforderungen zu stellen, da dem Vermittler klar sein muss, was für eine weitreichende Erklärung er abgibt. Unwirksam sind natürlich auch Anerkenntnisse, die etwa durch Täuschung oder Drohung erlangt wurden.
Wenn der Vermittler die Richtigkeit der Abrechnung bestreitet, so liegt der Ball wieder im Feld des Vertriebes. Dieser muss nun die Berechtigung jeder Position, für die er von der Vermittlerin oder dem Vermittler Geld verlangt, vor Gericht erläutern. Das gilt im Grundsatz für alle Positionen ab Vertragsbeginn. Hat das Vertragsverhältnis über viele Jahre hinweg bestanden, so führt das dazu, dass das Vorbringen des Vertriebes sehr umfangreich ausfallen kann, einfach weil sehr viele Positionen betroffen sind.
Bei Versicherungsvertretern (so auch hier) resultiert ein negativer Abrechnungs-Saldo sehr häufig daraus, dass gezahlte Provisionen storniert und daher ganz oder teilweise zurückgefordert werden. Grund dafür kann z.B. sein, dass ein vermittelter Versicherungsvertrag gekündigt wurde oder der Versicherungsnehmer bzw. die Versicherungsnehmerin keine Beiträge mehr bezahlt.
In solchen Fällen muss der Vertrieb zu jedem stornierten Vertrag näher erläutern, aus welchen Gründen das Storno erfolgt ist, wie sich die genaue Höhe der Stornierung ermittelt und ob und wie versucht wurde, das Storno zu verhindern. Letzterer Punkt betrifft die sogenannten Nachbearbeitungsmaßnahmen.
Was sind Nachbearbeitungsmaßnahmen?
Die Nachbearbeitung von Versicherungsverträgen kann im Wesentlichen auf zwei Wegen erfolgen:
Entweder erhält der Vermittler bzw. die Vermittlerin sogenannte Stornogefahrmitteilungen. Das heißt, es erfolgt eine Information darüber, dass ein Vertrag stornogefährdet ist, z.B. weil der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag gekündigt hat. Die rechtzeitige Übersendung dieser Stornogefahrmitteilung reicht als Nachbearbeitungsmaßnahme aus, wenn die Vermittlerin oder der Vermittler dadurch die Möglichkeit hat, das drohende Storno zu bekämpfen.
Oder der Unternehmer bzw. die Versicherung ergreift eigene Maßnahmen, um den Vertrag zu retten. Hierzu ist eine Kontaktaufnahme mit dem Kunden erforderlich, die auf dieses Ziel gerichtet ist.
Der Unternehmer muss im Prozess detailliert erläutern, welche Nachbearbeitungsmaßnahmen er wann zu jedem Vertrag ergriffen hat.
Es kann Ausnahmefälle geben, in denen eine Nachbearbeitung nicht notwendig ist (sagen wir, der Versicherungsnehmer ist bedauerlicher Weise verstorben. In diesem Fall muss kein Kontakt zu ihm im Jenseits aufgenommen werden, damit er weiter seine Beiträge zahlt). Auch diese Fälle muss der Unternehmer im Prozess erläutern.
Ist diese Erläuterung im Prozess unzureichend oder fehlt sie ganz, so kann der Vertrieb aus seinen Buchungen in der Abrechnung keine Forderung gegen den Vermittler oder die Vermittlerin herleiten.
Im Fall des OLG Karlsruhe war es der DVAG nicht gelungen, die einzelnen Positionen der Abrechnung ausreichend zu erklären. Insbesondere fehlten Angaben zu den Nachbearbeitungsmaßnahmen. Das OLG Karlsruhe hat daher – wie bereits vorher das LG Mosbach – die Klage der DVAG gegen meine Mandantin abgewiesen.

Anspruch der Vermittlerin auf Auszahlung der Stornoreserve
Was aber ist nun mit der Stornoreserve, die ja in den Abrechnungen vollständig verrechnet worden war?
Bei der Stornoreserve handelt es sich um einen Teil der Provision für die Vermittlung von Verträgen. Dieser Teil (meist 10-20 % der Gesamtprovision für einen Vertrag) wird vom Vertrieb nicht ausbezahlt, sondern zur Sicherheit einbehalten. Wie der Name schon sagt, dient die Reserve der Absicherungen von Stornierungen – aber natürlich nur von berechtigten Stornierungen!
Wie hoch die Stornoreserve zu einem bestimmten Zeitpunkt (Stichtag) ist, lässt sich den Abrechnungen des Vertriebes entnehmen. In den monatlichen Abrechnungen ist in aller Regel die Höhe der Stornoreserve mit angegeben.
Die Vermittlerin konnte sich auf diese Abrechnung auch berufen, ohne hier weitere große Erläuterungen zu einzelnen Verträgen oder Buchungen abzugeben. Das hat einen einfachen Grund: die Stornoreserve wurde durch den Vertrieb selbst abgerechnet! Wenn die Vermittlerin oder der Vermittler mit dieser Abrechnung zu einem bestimmten Stichtag einverstanden ist, bedarf es keiner weiteren Worte. Denn beide Parteien (also Vertrieb und Vermittler) sind ja der Ansicht, dass die Stornoreserve zu dem bestimmten Stichtag korrekt abgerechnet ist. Es besteht also gar kein Streit darum, wie hoch die Stornoreserve zu diesem Stichtag war.
Die DVAG hat nun freilich eingewendet, dass zeitlich nach diesem Stichtag die Stornoreserve Stück für Stück abgeschmolzen sei, bis alles weg war. Grund hierfür sei gewesen, dass die Verträge, für deren Vermittlung eine Stornoreserve gebildet wurde, storniert worden seien.
An dieser Stelle schließt sich gewissermaßen der Kreis. Denn die Stornierungen betreffen genau dieselben Verträge, die auch zu dem Sollsaldo geführt haben, der ursprünglich der Grund für die Klage der DVAG war. Das Gericht hatte aber zu diesen Verträgen schon festgestellt, dass die Stornierungen unberechtigt waren und die Forderung daher nicht besteht.
Wenn aber die Stornierungen unberechtigt vorgenommen wurden, konnte damit auch nicht wirksam die Stornoreserve abgeschmolzen werden.
Weil also die Stornoreserve nicht wirksam mit Stornierungen verrechnet werden konnte, stand die Stornoreserve nach wie vor der Vermittlerin zu. Diese konnte sie somit auch verlangen, von einem sehr kleinen Teil abgesehen, bei dem die zugrundeliegenden Haftungszeiten noch nicht vollständig abgelaufen waren.
So hat das OLG Karlsruhe dann auch entschieden und die oben gestellten Fragen wie folgt beantwortet:
- DVAG steht kein Anspruch aus ihrer Abrechnung zu.
- DVAG muss die Stornoreserve an die Vermittlerin auszahlen.

In meiner Anmerkung zu diesem Urteil in der Zeitschrift für Vertriebsrecht, Heft 6/2017, Seite 377ff, gehe ich noch etwas vertieft auf die rechtlichen Hintergründe der Entscheidung ein. Für diejenigen, die daran Interesse und ausreichend Lebenszeit zur Verfügung haben, habe ich das Urteil nebst Anmerkung nachstehend und im Bereich „Dokumente“ dieser Website hinterlegt.
OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.09.2017, 15 U 7/17, ZVertriebsR 2017, 377 mit Anm. RA Lost.

von Alexander Lost | 9. Dez. 2017 | Eigenbedarf, Kündigung des Mietvertrages, Mietrecht, Zivilrecht
In einem Fall vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main ging es um die Kündigung eines Mietvertrages wegen Eigenbedarfs.
Die erste Kündigung
Meine Mandanten sind seit fast 20 Jahren Mieter einer Wohnung in Frankfurt. Der Vermieter erklärte im Jahr 2015 die Kündigung, weil er die Wohnung für sich selbst benötige. Wie man weiß, kann ein solcher Eigenbedarf durchaus einen guten und tragfähigen Grund für eine Kündigung darstellen. Also hat der Vermieter meine Mandanten auf Räumung der Wohnung verklagt. In den Prozessen, die sich um eine Kündigung wegen Eigenbedarfs drehen, geht es häufig darum, ob der Eigenbedarf wirklich besteht und ausreichend ist, um die Kündigung zu rechtfertigen.
Verfahren wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs
Wie eine
Umfrage unter Berliner Richterinnen und Richtern ergab, häufen sich wohl die Verfahren, in denen es darum geht, dass der Vermieter einen Eigenbedarf nur vortäuscht. Wird der Eigenbedarf vorgetäuscht und zieht die Mieterin oder der Mieter deshalb aus, so kommen Schadensersatzansprüche gegen die Vermieterin resp. den Vermieter in Betracht
Der Gesetzgeber möchte Mieter aber davor schützen, dass ein Eigenbedarf erst geschaffen wird und dadurch Mieter/innen verdrängt werden, wenn das Mietverhältnis schon längst besteht. Er hat deshalb eine Sperrfrist bestimmt, innerhalb derer eine Eigenbedarfskündigung von vornherein nicht ausgesprochen werden kann, wenn
- nach Beginn des Mietvertrages
- Wohnungseigentum an der Wohnung begründet wurde und
- danach diese Wohnung verkauft wurde.
Diese Regelung findet sich in § 577a Absatz 1 des BGB. Die Sperrfrist beträgt nach dem BGB drei Jahre nach dem (erstmaligen) Verkauf der Wohnung. Sie kann aber durch die Gesetzgeber der Bundesländer auf bis zu 10 Jahre verlängert werden.
Der hessische Gesetzgeber hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und eine Verordnung erlassen. Für bestimmte Gebiete, unter anderem für Frankfurt am Main, ist darin festgelegt, dass die Sperrfrist zehn Jahre beträgt, wenn das Wohnungseigentum vor dem 31.12.2009 veräußert wurde. Diese kleine Verordnung namens KündBGebV HE hat nur zwei Paragraphen, die aber für Mieter und Vermieter eine große Auswirkung haben können. So auch hier § 1 Absatz 2 der KündBGebV HE!
In unserem Fall wurde das Wohnungseigentum erst im Jahr 2004 (also zeitlich nach Übergabe der Wohnung an die Mieter) begründet. Der aktuelle Vermieter hat die Wohnung im Jahr 2008 (also zeitlich nach der Umwandlung in Wohnungseigentum und vor dem 31.12.2009) gekauft. Das heißt, die Zehn-Jahres-Frist nach der hessischen Verordnung begann frühestens im Jahr 2008. Vor Ablauf von zehn Jahren nach dem Kauf der Wohnung kann der Vermieter die Wohnung also nicht wegen Eigenbedarfs kündigen. Die Klage des Vermieters wurde abgewiesen, weil die zehn Jahre im Jahr 2015 noch nicht vorbei waren. Die Kündigung war aus diesem Grunde unwirksam.
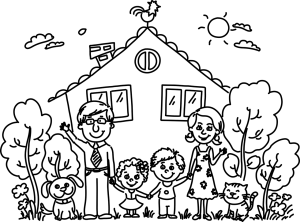
Die zweite Kündigung
Der Fall hat eine weitere interessante Komponente: mitten im Prozess hat der Vermieter plötzlich eine neue Kündigung ausgesprochen, und zwar eine fristlose. Grund war, dass meine Mandanten wegen bestimmter Mängel schon vor Jahren die Miete gemindert hatten. Der Vermieter war freilich der Ansicht, die Wohnung sei tutti paletti. Deshalb hat er die fristlose Kündigung wegen rückständiger Miete erklärt, weil die Minderung ja unberechtigt sei.
Mit dieser zweiten Kündigung musste das Gericht sich aber gar nicht beschäftigen. Sie hat nämlich mit der ursprünglichen Kündigung wegen Eigenbedarfs überhaupt nichts zu tun und gehört daher nicht in den Prozess wegen der Eigenbedarfskündigung (außer die Mieter sind damit einverstanden).
Details zum Verfahren
Zivilprozessual ist hier die Frage einer Klageänderung nach § 263 ZPO angesprochen. Ändert der Kläger seine Klage nach dieser Vorschrift und widerspricht der Beklagte der Klageänderung, so ist die Klageänderung nur zulässig, wenn sie aus Sicht des Gerichtes sachdienlich ist.
Hier musste das Gericht zunächst entscheiden, ob überhaupt eine Klageänderung vorliegt, denn der geltend gemachte Anspruch (Räumung der Wohnung) hat sich ja überhaupt nicht geändert. Wenn aber derselbe Anspruch mit einem ganz anderen Sachverhalt als ursprünglich begründet wird, liegt gleichwohl eine Klageänderung vor, denn nun soll das Gericht ja den anderen, neuen Sachverhalt prüfen. Das gilt auch, wenn der neue Sachverhalt nur zusätzlich in den Prozess eingeführt wird, so wie hier.
Die Klageänderung war auch nicht sachdienlich. Denn der neue Sachverhalt (die fristlose Kündigung) stand mit dem ursprünglichen Sachverhalt (Kündigung wegen Eigenbedarfs) in keinem Zusammenhang. All das, was der Kläger zum Eigenbedarf schriftsätzlich vorgetragen hat, konnte bei der Prüfung der neuen fristlosen Kündigung nicht verwertet werden. Deshalb war es nicht sachdienlich. Als Gegenbeispiel ein Beschluss des BGH vom 27.10.2015: dort war die ursprüngliche Kündigung wegen Mietrückstands aufgrund unberechtigter Minderung ausgesprochen worden. Auch die neue Kündigung (die Klageänderung) bezog sich auf denselben Mietrückstand und dieselbe Minderung, nur für einen späteren Zeitraum. In diesem Fall des BGH konnten also die bisherigen Erkenntnisse des Prozesses auch für die Prüfung der neuen Kündigung verwertet werden. Deshalb war die Klageänderung dort – und anders als in meinem Fall – sachdienlich.
Die Klage des Vermieters wurde also wegen einer kleinen hessischen Verordnung abgewiesen.
Urteil AG Frankfurt am Main vom 08.11.2017, Az. 33 C 2574/16 (50)

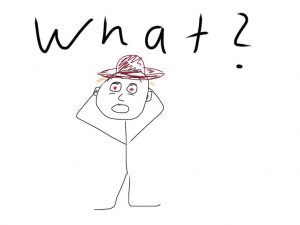








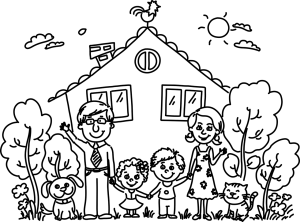

Neueste Kommentare